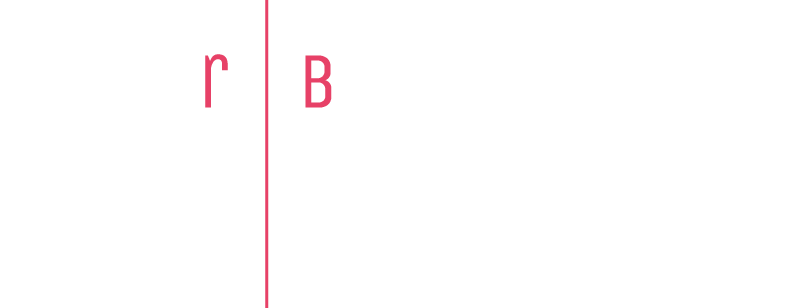2020-04-30 / Die Mechanik des Geistes
Die Mechanik des Geistes
Warum Führungskräfte unbedingt viel von Psychologie verstehen müssen.
Psychologie ist nicht nur etwas für Psychologen. Auch Führungskräfte müssen sich bestens damit auskennen. Denn Psychologie heißt, die Funktionsweise unseres Geistes verstehen.
Jedes Mal wenn es etwas persönlicher wird, wenn die Führungsanforderung über das technische Fachwissen hinauszugehen droht, sehe ich, wie sich die Führungskräfte um mich herum versteifen. Das Lächeln wirkt aufgesetzt, der Blick ist flüchtig. Nur manchmal traut sich einer deutlich zu sagen, was er gerade denkt. „Das ist doch Psychologie…“ In dieser Aussage liegt ein Meer an Misstrauen und Verachtung.
Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Psychologie wird auch heute noch zum größten Teil als etwas gesehen, das mit Krankheit zu tun hat. Und zwar eine sehr unangenehme Art der Krankheit, die Krankheit des Geistes. „Geh mal zum Psychologen“, ist eine Aufforderung, die ziemlich negativ gemeint ist, auch, wenn sie voller Fürsorge ausgesprochen wird.
Aus dieser Perspektive hat Psychologie im Unternehmen nichts verloren, schon gar nicht in einem guten alten deutschen Unternehmen, in dem solide gearbeitet wird und keine „großen G’schichten g’macht“ werden. Die typische deutsche Führungskraft ist ein Meister oder ein Ingenieur (der verschiedensten Fachrichtungen), der sich nach oben gedient hat und sein Geschäft gut kennt. Wo und wann bitte sollte man hier Psychologie brauchen? Die Mitarbeiter bekommen die Marschroute vorgegeben und zusätzlich hat die Führungskraft immer ein offenes Ohr für alle. Je nach Charakter gibt es obendrein noch eine nette persönliche Beziehung oder einen professionellen Umgang, dem Geschmack der Führungskraft entsprechend.
Gar keine Frage, diese Herangehensweise kann gut funktionieren. Allerdings darf nichts schiefgehen. Die Mitarbeiter müssen zuverlässig ihre Arbeiten erledigen, die Projekte müssen halbwegs reibungslos über die Bühne gehen usw. Aber wenn der Wind aus dem Markt anfängt härter zu wehen, das Unternehmen ein paar Investitionsstaus entstehen lässt, die Qualität anfängt zu leiden, die Termintreue zum Dauerthema wird, dann reicht diese Basisführungsarbeit möglicherweise nicht mehr aus.
Das neue Arbeitszeitgesetz im viralen Lichte betrachtet
Verantwortung und Vertrauen sollten in einer Zeit wie der unsrigen die beiden Zauberworte sein. Doch neue Arbeitszeitgesetze sprechen eine andere Sprache, die im Lichte der aktuellen SarS-CoV-2-Krise zum babylonischen Durcheinander führen.
Das neue Arbeitszeitgesetz 2020 der EU fordert die Arbeitgeber auf, die tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiter zu erfassen. Und zwar auf die Minute genau. Zumindest ist das eine logische Schlussfolgerung dieses neuen Gesetzes. Wie genau die deutschen Gesetze angepasst werden, bleibt abzuwarten. Sinn oder Unsinn dieser Entscheidung kann trefflich diskutiert werden. Interessant ist aber vor allem die Frage, was eine solche Initiative über unsere heutige Welt aussagt. Weiterhin wirft die gegenwärtige Krise (dieser Beitrag wird geschrieben im Jahre des Herrn 2020, am 28. März oder Tag 9 der bayrischen Ausgangsbeschränkung) ein besonderes Licht auf die gesamte Frage unserer Arbeitsweise.
Was sagt nun dieses Gesetz aus? Dass wir Menschen nach wie vor nicht reif genug sind, um auf ein Gesetz zu verzichten, das im Grunde nichts anderes besagt, als dass wir vernünftig mit unseren Kräften umgehen sollten. Offensichtlich klappt es nicht; deshalb muss ein Gesetz her, das den schwachen Arbeitnehmer gegen den mächtigen und gierigen Arbeitgeber verteidigt.
mehr lesen…2019-06-12 / Alles eine Frage des Glaubens
Alles eine Frage des Glaubens
Überzeugungen und Glauben tragen entscheidend zum Funktionieren des Unternehmens bei.
Wenn wir eine Veränderung anstreben, müssen wir bei der Kommunikation die „Glaubensfragen“ berücksichtigen, die im Unternehmen herrschen. Tun wir das nicht, stoßen wir möglicherweise an eine gläserne Wand, ohne zu verstehen, warum unser Projekt nicht vom Fleck kommt.
Es ist in unserer Menschheitsgeschichte noch nicht so lange her, da glaubten alle Wissenschaftler (die damals noch nicht diesen Namen hatten), die Erde sei der Mittelpunkt des Universums oder zumindest unseres Sonnensystems. Auf diesem Glauben bauten ihre Berechnungen auf. Das System wird das ptolemäische Weltbild genannt. Ein anderer Ausdruck ist „geozentrisches Weltbild“. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es auch heute noch viele Menschen, selbst in den sogenannten „entwickelten“ Ländern, die an ein geozentrisches Weltbild glauben, allerdings aus religiösen Gründen.
Geschichtliche/Wissenschaftliche Fakten zum Glauben
Doch in diesem Beitrag soll es in Verbindung mit dem Begriff „Glauben“ nicht um Religion gehen, mit dem er oft assoziiert wird. Wir glauben sehr vieles, das wenig oder nichts mit Religion zu tun hat. So auch in der Zeit vor Kopernikus, in der die Astronomen an eine geozentrische Realität glaubten und all ihre mathematischen Berechnungen auf dieser Überzeugung aufbauten. Und es funktionierte tatsächlich erstaunlich gut! Die Bahnen der Planeten und des Mondes konnten mit beachtlicher Präzision berechnet werden. Sogar noch 150 Jahre nach Kopernikus ergaben diese Berechnungen genauere Ergebnisse als diejenigen des heliozentrischen Weltbildes. Da das System funktionierte, musste es zwangsläufig wahr sein. Allerdings bröckelte im Lauf der Jahrhunderte, mit zunehmender Genauigkeit der Beobachtungen, der Putz ab. Zu viele komplizierte Konzepte waren nötig, wie zum Beispiel die primären und sekundären Epizyklen, um die Beobachtungen mit der Mathematik in Einklang zu bringen. Schließlich setze sich ein neues Weltbild durch, an das die heutigen Astronomen fest glauben, da es uns erlaubt, Sonden auf die Planeten zu schicken und die Beobachtungen, die unser Weltraumteleskop macht, zuverlässig zu erklären.
In der Wissenschaft gab es öfter solche Umwälzungen, die ein Glaubenssystem durch ein anderes ersetzten. Einsteins Relativitätstheorie stieß die Himmelsmechanik Newtons vom Thron, unter anderen weil sie eine kleine Unregelmäßigkeit in der Umlaufbahn von Merkur (die Periheldrehung, merken Sie sich das bitte nicht) wesentlich genauer erklären und berechnen konnte. Heute arbeiten Kernphysiker mit dem sogenannten Standardmodell, das bisher durch alle Beobachtungen bestätigt wird. Experten schließen aber nicht aus, dass das Ganze auf einer völlig falschen Grundannahme beruht. Vielleicht ist in gewisser Weise die Genauigkeit der Vorhersagen nur Glück und eine andere Theorie, die mit ganz anderen Prämissen arbeitet, liefert noch wesentlich bessere Ergebnisse und löst Fragen, vor denen wir heute noch wie der Ochs vor dem Berg stehen.
Soweit die große Geschichte. Ähnliche Beobachtungen lassen sich natürlich in anderen Bereichen machen. Glaube wirkt an vielen Stellen unserer Gesellschaften weltweit[1]. Auch in unserem Unternehmen läuft vieles auf der Grundlage von Glauben, der eine wirksame Technik für menschliche Zusammenarbeit darstellt.
mehr lesen…
2019-04-02 / Da kann man nichts machen…
Da kann man nichts machen…
Der richtige Umgang mit Unabänderlichem
Als Führungskräfte haben wir die Aufgabe, für das Erreichen von Zielen zu sorgen. Dafür braucht man Pläne. Diese Pläne werden aufgrund unseres aktuellen Wissensstands entworfen. Doch dann kommt die Realität. Und die kommt oft anders, als geplant. Wie kommuniziert man als Führungskraft, vor dem Hintergrund sich ständig verändernder Umstände, die heute den Plan von gestern über den Haufen schmeißen?
„Oft kommt es anders und zweitens als gedacht…“ Diese humorvolle Redewendung ist ein Versuch, mit den unabänderlichen Realitäten des Lebens umzugehen. Gleichzeitig nimmt sie unsere Kontrollillusion (http://www.sinnvermitteln.de/2018/09/01/kontroll-illusion/) aufs Korn und zeigt uns, dass wir nur begrenzt die Herren unseres Schicksals sind. Diese Tatsache ist gerade für Führungskräfte schwer zu akzeptieren. Werden sie doch genau dafür bezahlt, sicher Ergebnisse zu produzieren. Niemand möchte nur zufällig einen bestimmten Ertrag erwirtschaften und aus Versehen neue Marktanteile gewinnen. Also heißt Managen im Grunde nichts anderes, als Pläne zu schmieden und permanentes kontrollieren, ob alles nach diesen Plänen läuft. Meistens macht sich hinterher niemand die Mühe, zu überprüfen, auf welche Weise ein bestimmtes Ergebnis erreicht wurde und wie sehr man darin noch den ursprünglichen Plan erkennen kann.
Daher äußere ich hier eine unbewiesene Vermutung, die jeder Leser für sich selbst überprüfen kann. Diese Vermutung soll Ihnen helfen, entspannter mit den Unwägbarkeiten des Arbeitsalltages umzugehen. Also: Ich vermute, dass ein Großteil der Ergebnisse in einem Unternehmen (sagen wir ca. 80 %) nicht so erzielt werden, wie der Plan es anfangs vorgesehen hatte. Irgendwie kommt man irgendwohin. Und manchmal ist es richtig gut, manchmal richtig schlecht und meistens liegt das Ergebnis irgendwo im Mittelfeld. Aber egal wie, es hat wenig mit der PowerPoint-Folie zu tun, die Frau Dr. Vorstand bei der Kick-Off-Veranstaltung am Anfang des Jahres gezeigt hat.
Diese Beobachtung gilt natürlich nicht für rein mechanische Prozesse, wie sie in jeder Produktion ablaufen. Die sind nämlich nicht so schwer in den Griff zu bekommen. Mechanik mag manchmal kompliziert sein. Aber sie hat die nette Eigenschaft, eine nachvollziehbare Folge von Ursachen und Wirkungen zu bieten. Zumindest, solange sich der Hersteller an einer Maschine nicht verkünstelt und eine so tolle Anlage konstruiert, dass selbst er nicht mehr durchblickt, wenn mal etwas nicht funktioniert. Dann taugt das Ganze meistens nichts.
2019-02-17 / Mit Lügen zum Ziel?
Mit Lügen zum Ziel?
Was (die meisten von) uns davon abhält, regelmäßig zu lügen.
Warum wird eigentlich nicht mehr gelogen? Durch eine geschickte Lüge kann sich doch jeder einen Vorteil verschaffen! Doch etwas hält uns davon ab, dieses unlautere Kommunikationsmittel einzusetzen. Das Stichwort heißt Vertrauen. Unser Erfolg als Mensch hängt von unserer Fähigkeit ab, zusammenzuarbeiten. Das wiederum geht nur, wenn genügend Vertrauen innerhalb der Gruppe herrscht. Doch wo ist die Grenze zwischen geschönter Wahrheit, mit der wir unser Image als Führungskraft pflegen wollen, und einer Lüge? Und bringen diese kleinen Unehrlichkeiten überhaupt etwas?
Lügen fällt uns ziemlich leicht. Zumindest, wenn es um Kleinigkeiten geht. Freilich, die Definition von „Kleinigkeiten“ ist dehnbar… Doch um die genaue Definition von Kleinigkeit soll es hier nicht gehen. Lügen ist eine gute Möglichkeit, sich Vorteile zu verschaffen, zumindest für diejenigen, die schnell genug im Denken sind, um sich nicht erwischen zu lassen. Wer sich etwas näher mit dem Thema „Lügen“ auseinandersetzt, kommt irgendwann zu dem Punkt, an dem er sich fragt, warum eigentlich nicht viel mehr gelogen wird. Was hält uns davon ab, die Wahrheit oder die Realität so zu verdrehen, dass wir daraus, oft auf Kosten anderer, einen echten Nutzen haben?
2018-12-22 / Das Unternehmen wünscht…
DAS UNTERNEHMEN wünscht…
Wie ein Produkt unserer Fantasie zur handelnden Person werden kann.
Immer wieder lesen wir in Zeitungen Formulierungen, in denen das Unternehmen als eigenständige, unabhängige Person dargestellt wird. „Das ist ein klares Bekenntnis zur Dezentralität von Bertelsmann…“ Kann etwas, das kein Mensch ist, sondern ein rein fiktives Konstrukt, überhaupt ein Bekenntnis ablegen? Haben Unternehmen eine eigenständige Existenz?
Schon früh habe ich mich gewundert, wer genau gemeint ist, wenn irgendwo die Rede davon war, dass ein Unternehmen eine Handlung ausführt: Position bezieht, verhandelt, ein anderes Unternehmen kauft, etwas verlautbaren lässt und so weiter. Natürlich war mir nach kurzem Nachdenken klar, was damit gemeint war. Ein Vertreter des Unternehmens handelte. Allerdings ist das auch wieder nur eine Zwischenlösung, da der betreffende Mensch im Namen des Unternehmens, als sein legaler Vertreter handelt. Also landete ich wieder bei meinem Problem, denn die Frage bleibt offen, wer denn da genau vertreten wird?
2018-10-16 / Lenins Mumie
LENINS MUMIE
Die Bedeutung von Symbolen in Unternehmen
Moskau investierte im Jahr 2017 174.000 EUR in den Unterhalt von Lenins Mumie.[1] Das geschieht mit Sicherheit nicht aus reiner Pietät. Moskau weiß um die Macht von Symbolen. Doch welche Symbole gibt es in Unternehmen, wie können sie eingesetzt werden und welche Auswirkung haben sie auf die Arbeit im Unternehmen?
Nicht nur Moskau unterhält teure Mumien, auch wenn nicht alle so prominent ausgestellt sind wie die Mumie des großen Revolutionsführers. Weitere bekannte zeitgenössische Mumien sind: Moa Ze Dong[2], Ho Tchi Min, Kim Jung Il, John F. Kennedy, um nur einige zu nennen. Diese wertvollen Herren frisch zu halten, kostet einiges. Nicht nur Lenin wird regelmäßig aufgehübscht.
Doch warum geben moderne Staaten, die allesamt von aufgeklärten Menschen geführt werden, ob diktatorisch oder nicht, Unmengen Geld für nutzlose Leichen aus? Mit Aberglauben oder Mystizismus hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass Väterchen Putin hofft, selbst einmal auf diese Weise unsterblich zu werden.
Der eigentliche Grund liegt in der Symbolkraft der taxonomierten Volks(-ver-)führer. Alle diese Männer repräsentieren etwas, das auch heute noch für die entsprechende Nation wichtig ist.
Denken wir über Lenin nach. Warum wird dieser Mann heute noch vor dem Kreml ausgestellt? Natürlich kann ich nicht mit Sicherheit wissen, wie die Russen darüber denken, werde mir aber erlauben, an dieser Stelle einige Vermutungen anzustellen.
Russland hat, mit der Auflösung der UDSSR, seinen Status als Imperium verloren. Damit ist ein altes Selbstverständnis des russischen Volkes verlorengegangen. Vor diesem Hintergrund steht Lenin als derjenige, der das russische Volk zu seiner bedeutendsten Größe geführt hat. Zunächst wurde die Herrschaft der Zaren abgeschüttelt. Dann wurde ein größeres Reich, als es das Zarenreich jemals war, durch die Sowjets erobert. Wenn man die Unannehmlichkeiten, die der Kommunismus in seiner diktatorischen Form mit sich brachte, ausklammert, war das eine beachtliche Leistung. Und Lenin war, zumindest gefühlt, die Quelle und der Ursprung dieses grandiosen Erfolgs. Daher ist er für die etwas frustrierte Russische Föderation eine wunderbare Identifikationsfigur. Er verkörpert etwas, das nicht verloren gehen soll, auch wenn die Sowjet-Zeit unwiederbringlich dahin ist. Seine körperliche Präsenz, direkt vor dem Zentrum der russischen Macht, erfüllt die Funktion eines Schutzpatrons der russischen Größe, der den Staat immer wieder daran gemahnt, was für Leistungen er vollbringen kann. Er ist eine Inspiration und eine Identifikationsfigur zugleich, die heute in Russland vermutlich wenige noch direkt mit dem Kommunismus als solchen in Verbindung bringen. Wer an Lenin denkt, denkt an den Mann, der aus Russland eine Weltmacht gemacht hat.
Welches Signal sendet der Kreml an seine Bürger, indem er fast dreißig Jahre nach dem Zusammenbruch des Imperiums, das Lenins Erbe war, seinen Körper weiterhin im Schaufenster zeigt? Das Signal lautet: „Wenn wir wirklich wollen, können wir.“ Dementsprechend hält die Russische Föderation drei Mal so viele militärische Manöver ab wie die Nato[3], obwohl es weder wahrscheinlich noch nützlich wäre, dass Russland irgendein Land, das heute zur Nato gehört, einnimmt. Doch in diesem Beitrag geht es natürlich nicht um geostrategische Überlegungen, sondern um Symbole.
2018-02-25 / Motivationskiller EBIT
EBIT vs. SINN
Warum Führungskräfte immer wieder das falsche Motivationswerkzeug aus der Kiste holen.
„‚Sie wollen, wie ich vermute, den ganzen Tag morgen haben‘, sagte der Chef. ‚Wenn Sie nichts dagegen haben, Sir.‘ ‚Es passt mir nicht‘, sagte der Chef, ‚und es ist nicht schicklich. Wenn ich Ihnen eine 200 dafür abrechnete, würden Sie denken, es widerfahre Ihnen Unrecht, nicht?‘ Der Mitarbeiter lächelte verzagt. ‚Und doch‘, sagte der Chef, ‚denken Sie nicht daran, dass mir Unrecht geschieht, wenn ich einen Tag Lohn für einen Tag ohne Arbeit bezahle.‘ Der Mitarbeiter bemerkte, dass es nur einmal im Jahr vorkäme. ‚Eine armselige Entschuldigung, um an jedem fünfundzwanzigsten Dezember einem den Geldbeutel zu bestehlen‘, sagte der Chef, indem er seinen Mantel bis an das Kinn zuknöpfte. ‚Aber ich vermute, Sie müssen durchaus den ganzen Tag frei haben. Seien Sie dafür übermorgen umso früher hier.'“ [1]
Vielleicht hat der eine oder andere geneigte Leser dieses (leicht angepasste) Zitat erkannt, ohne sich die Fußnote anzusehen? Diese archaisch anmutende Szene aus Dickens zu Recht berühmter Weihnachtsgeschichte, bleibt bis heute ein Sinnbild der Beziehung zwischen Manager und Mitarbeiter. Scrooge (so heißt der Chef in der Geschichte), wünscht sich im Grunde von seinem Sekretär, er solle auf den Weihnachtsfeiertag verzichten und, statt mit seiner Familie herumzuhängen, für deren Belange Scrooge sich nicht im geringsten interessiert, auch am 25. Dezember in den unterkühlten Kontor kommen.
Doch, Hand aufs Herz, wie oft wünschen sich Verantwortliche beim Blick auf die Kapazitätsplanung, der Sonntag möge ein ganz normaler Arbeitstag sein, vom Samstag ganz zu schweigen? Man selbst arbeitet ja so hart, die Beschäftigten verstehen das gar nicht. Und dann sind sie auch noch so unkooperativ und halten stur an ihrem Wochenende fest. Nennt man so etwas Loyalität gegenüber dem Unternehmen? Sicher nicht!